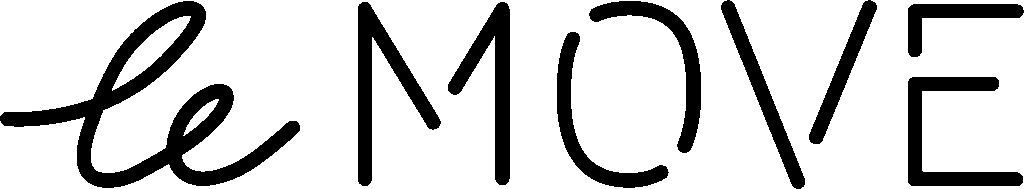Finanzierungsmöglichkeiten im Sport
#Finanzierung #Karriere im Sport
Worauf geachtet werden muss
Ein Podestplatz bei einem wichtigen Turnier oder einfach ein Sieg gegen die härteste Konkurrentin – es ist die Leidenschaft für den Sport, die die Frauen antreibt. Denn den Weg in den Leistungssport suchen sich Sportlerinnen wohl nicht wegen des hohen Verdienstes. In nur wenigen Sportarten gibt es Siegesprämien zu gewinnen, von denen man finanziell gut leben kann. Tennis übernimmt vor allem mit den ausgeschriebenen Preisgeldern bei Grand Slams eine Vorreiterrolle. Doch der Weg an die Weltspitze ist hart und weit, vor allem weil die Konkurrenz in jeder Sportart groß ist.
Allein von den sportlichen Erfolgen zu leben, ist in Österreich kaum möglich.
Unterschiedliche Möglichkeiten
Bei Spenden handelt es sich um freiwillige Geld- oder Sachleistungen, die als Unterstützung für die Sportlerin dienen sollen. Sie kommen dann meist von einem Unternehmen oder auch einer Privatperson. Für die Sportlerin ist das wohl der beste Deal, denn die Geldgeberin oder der Geldgeber erwarten sich keine Leistung in retour.
Anders ist es jedoch beim Sponsoring. Hier gehen die Sportlerinnen mit einer Firma oder einer Privatperson eine Partnerschaft ein. Das bedeutet, dass der Sponsor oder die Sponsorin Geld- oder Sachleistungen zur Verfügung stellt, Gegenleistungen aber auch explizit in einem Vertrag festgehalten werden. Das kann verschiedene Werbedeals oder auch Branding betreffen. Meist ist es der Fall, dass Sportlerinnen eine Aufschrift am Sportgerät oder der Sportkleidung tragen oder sich für andere Gegenleistungen bereit erklären. Klar, ein erster oder neuer Sponsorenvertrag kann aufregend sein, den Vertrag genau zu lesen und kennen zahlt sich aus. Denn Vereinbarungen müssen streng eingehalten werden. Ansonsten haben eine Sponsorin oder ein Sponsor die Möglichkeit diese rechtlich zu erzwingen.

Während die Sportlerin finanzielle Unterstützung erhält, sieht der Sponsor oder die Sponsorin diese Partnerschaft meist als geschäftliche Investition. So erfolgt ein Sponsorenvertrag meist nicht unüberlegt. Die gesponserte Sportlerin muss sich für die Marke als Werbeträgerin eignen. Ein positiver Öffentlichkeitsauftritt der Sportlerin ist essenziell. Leistet man sich einen Fauxpas, kann der Deal schnell einmal Geschichte sein. Je bekannter und erfolgreicher sie ist, desto einfacher wird es sein, neue und weitere Sponsorings für sich zu gewinnen. Eine Herangehensweise neue Partnerschaften zu finden, kann eine gute Selbstdarstellung auf Social Media und ein häufiges Vorkommen in Medienberichten sein. Wer häufig und gut in der Öffentlichkeit steht, weckt Interesse. Ein neuer Sponsoringvertrag steht dann vielleicht schon bald vor der Tür.
Beim Crowdfunding hingegen ist man auf die Hilfe von mehreren Menschen angewiesen. Über verschiedene Plattformen haben Sportlerinnen die Möglichkeit, um Spenden zu bitten. Eine bestimmte Spendensumme gibt es dabei nicht, jeder Cent zählt. Diese Art ist eine gute Möglichkeit sich Turnierreisen oder Trainingsstunden zu finanzieren. Über Social Media oder Vereins-Websites wird dann meist zum Spenden aufgerufen. Anders als beim Sponsoring ist eine Gegenleistung nicht immer notwendig. Über eine kleine Geste, wie zum Beispiel einer Grußbotschaft oder Dankeschön-Geschenke, freuen sich die Spendenden mit Sicherheit.
Unternehmerin sein

Gewinnt man Preisgeld, ist die Freude sicherlich erstmal groß. Aber Vorsicht.
Wenn die Einnahmen der Sportlerin unter 35.000 Euro pro Jahr bleiben, fällt sie in die Kategorie der Kleinunternehmerregelung. Es kommt dann zwar zu keiner Umsatzsteuerpflicht, sie können aber auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Sind die Einnahmen aus der sportlichen Karriere jedoch höher, als die Ausgaben, dann gilt man bereits als Unternehmerin. Auf der Rechnung muss die Umsatzsteuer aufscheinen und der Steuersatz liegt bei 20 %.
Berufssportlerinnen erzielen grundsätzlich Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb (VwGH 24.2.1982, 81/13/0159), sofern eben Selbständigkeit als Unternehmerin gegeben ist. Wenn Sportlerinnen sich allerdings, zum Beispiel mit einem Verein, verpflichten an einer bestimmten Anzahl von Wettkämpfen teilzunehmen und dabei der sportliche Erfolg im Vordergrund steht, liegt ein Werkvertrag vor. Auch dieser führt zu Einkünften aus Gewerbebetrieb (VwGH 24.02.1982, 81/13/0159).
Gewinnt man Preisgeld, ist die Freude sicherlich erstmal groß. Aber Vorsicht: Denn auch die können steuerpflichtig sein. Und zwar hängt das davon ab, wer Veranstalterin und Veranstalter ist. Ist eben diese oder dieser eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, muss man die Preisgelder in dem Land versteuern, wo die Firma ihren Sitz hat. Handelt es sich bei der Veranstalterin oder dem Veranstalter um keine Unternehmerin oder keinen Unternehmer, sind die Gelder an dem Ort steuerbar, an dem die Veranstaltung stattfindet.

Dokumentation erforderlich
Die steuerlichen Pflichten können für Sportlerinnen ein komplexes Thema abbilden, wer den Überblick behalten will, führt am besten genau Buch. Denn wer einen klaren Kopf über Einnahmen und Ausgaben behält, tut sich leichter und umgeht Probleme.
Aber Achtung: Bei abgabenpflichtigen Personen ist die Aufzeichnung nicht freiwillig. Gemäß § 126 BAO haben Abgabepflichtige und die zur Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben verpflichteten Personen jene Aufzeichnungen zu führen, die nach Maßgabe der einzelnen Abgabenvorschriften zur Erfassung der abgabepflichtigen Tatbestände notwendig sind.
Ob die Sportlerin Spenden nun von einer Privatperson oder einem Unternehmen erhält, macht jedoch keinen Unterschied. Denn sobald sich der Geldgeber oder die Geldgeberin gewisse Gegenleistungen von der Sportlerin erwartet, wie zum Beispiel das Tragen des Sponsorennamens oder der Auftritt bei Events, ist dies für gewöhnlich in einem Vertrag festgehalten. Sobald es diesen also gibt, handelt es sich bei den bezahlten Geldern um Betriebseinnahmen und sind somit steuerpflichtig. In Österreich sind Schenkungen zwischen Angehörigen bis 50.000 Euro innerhalb eines Jahres steuerbefreit. Zwischen anderen Personen beträgt die Grenze pro Person 15.000 Euro innerhalb von fünf Jahren.
Jene Aufzeichnungen dürfen Sportlerinnen und deren Vereine keinesfalls löschen oder wegwerfen, da gemäß § 132 BAO Bücher und Aufzeichnungen, sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen Belege sieben Jahre aufzubewahren sind. Hinzukommt, dass sie in weiterer Folge auch für Abgabenerhebung relevante Verfahren von Bedeutung sein können. Seitens des Finanzamtes wird den Sportlerinnen empfohlen, aufzuzeichnen, von wem, an wen und in welcher Höhe eine Spende geleistet wurde.

PRAE als weitere Möglichkeit
Selten sind Sportlerinnen bei einem Verband oder einem Verein angestellt. Für Sportlerinnen gibt es dennoch eine Möglichkeit sich etwas dazuzuverdienen – und zwar mit der pauschalen Reiseaufwandsentschädigung (kurz PRAE). Gemeinnützige Sportvereine und -verbände können an ihre Mannschafts- und Einzelsportlerinnen nämlich unter bestimmten Voraussetzungen für ihre sportlichen Tätigkeiten eine pauschale Reiseaufwandsentschädigung ausbezahlen. Diese ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Die PRAE ist allerdings nur dann in der Sozialversicherung beitragsfrei, wenn die Frau ihren Sport nebenberuflich ausübt. Die Auslegungssache des Hauptberufes ist groß. Denn als Hauptberuf zählen beispielsweise auch ein Studium und die Tätigkeit als Hausfrau in einem Familienverband.
Es spielt keine Rolle, ob die Sportlerinnen jene Zahlungen als Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, selbständiger Tätigkeit, wie zum Beispiel als Freiberuflerin, gewerblicher Tätigkeit oder als sonstige Einkünfte eingestuft werden. Die Zuordnung ist nämlich erst dann relevant, wenn eingeordnet wird, ob eine Sozialversicherungs-Pflicht nach dem ASVG oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) vorliegt. Bei Mannschaftssportarten wird die Steuer vom Verein einbehalten und an das Finanzamt gezahlt, Einzelsportlerinnen sind als Empfängerinnen für die Versteuerung selbst verantwortlich.